©Bandai Visual
© TMDB
Drehbuch: Kazunori Ito
Schnitt: Shuichi Kakesu
Kamera: Hisao Shirai
Schauspieler*innen: Atsuko Tanaka, Akio Otsuka
Land: Japan
Sprache: Japanisch
Länge: 1h23min
Genre: Science-Fiction, Thriller, Action, Animation
Weniges lastet schwerer auf der mentalen Sicherheit als das Unbekannte. So können beispielsweise ein nicht klassifizierter, bakterieller Infekt und dessen unvorhersehbare Konsequenzen Panik auslösen, da viel damit einhergeht, ob man sich kognitiv auf einen Zustand vorbereiten kann oder nicht. Ist man imstande den Feind zu sehen – sei es nur im übertragenen Sinne -, fühlt man sich komischerweise besser, obwohl es am Resultat nur in der Theorie etwas ändert. Informationen sind dem menschlichen Gehirn wichtig, da sie Bilder und Vorstellungen kreieren, die der Regulierung des Gefühlszentrums dienen. Wenn man aber einmal zu zweifeln begonnen hat, hört man damit nicht so leicht wieder auf, wie es Agent Batou (Akio Otsuka) gegenüber seinem Vorgesetzten erwähnt.

Ungewisse Intentionen
Im Tokio des Jahres 2029 ist nämlich keine Krankheit die große Unbekannte, sondern ein vermeintlich bevorstehender Terroranschlag auf virtueller Ebene. Ausgehend von einem nicht identifizierten Hacker, der überall lediglich als „Puppetmaster“ bekannt ist, liegt es in der Verantwortung von Majorin Motoko Kusanagi (Atsuko Tanaka) und ihrem Team besagten Anschlag zu vereiteln. In einer modernisierten Welt, in der Technologie den Alltag praktisch aktiv und in physischer Präsenz mitgestaltet, ist dies jedoch kein simples Unterfangen. Sogar die Menschen sind teilweise nicht mal mehr das, wo Kusanagi keine Ausnahme bildet. Zwar ist sie Herrin über ihre eigenen Gedanken und Empfindungen, ist sich der Upgrades ihres Körpers und Geistes aber völlig bewusst.
Während ihr Ghost – das psychische Bewusstsein, aus dem sich eine Seele bildet – an die Anforderungen ihrer Arbeit und somit ganz nach den Wünschen des Arbeitgebers angepasst ist, gehört alles, was ihr Inneres betrifft, ihr allein. Eher arbeitet ihr Shell – der humanoide aber optimierte Körper – ganz im Interesse anderer, da sie mit dessen Hilfe sämtliche Einsätze und Aufträge bei höchster Effizienz absolviert. All dies bringt ihr im ersten Moment allerdings nur bedingt etwas, weil sie einem Gegner gegenübersteht, der die Risiken und Befürchtungen einer solchen neofuturistischen Welt bündelt und Realität werden lässt. Dabei sind die Intentionen des Hackers absolut ungewiss. Ob sie harmloser oder bösartiger Natur sind, soll jedoch gemessen am Zerstörungspotenzial der Bedrohung nebensächlich begutachtet werden. Zu hoch könnte der Schaden ausfallen, zu schwer tragbar für die Menschheit.
Gemeinsam mit der Protagonistin fragt sich somit auch das Publikum automatisch, wovor man tatsächlich Angst haben sollte. Immerhin ist auch sie ein Produkt kybernetischer Raffinessen und alle Aspekte ihrer Persönlichkeit die Summe von Entscheidungen, die ihr bereits vor der Entstehung abgenommen worden sind. Dies betont sie oft genug und umso öfter sie es tut, desto mehr lassen sich Unsicherheiten erkennen. Im Metier der Überwachung und Paranoia ist selbst die Differenzierung eigener Worte problematisch, wie sie im Beisein von Batou feststellt, als sie auf einem Boot von falscher Freiheit als Individuum lamentiert. Direkt fragt Batou, wer eben aus ihr gesprochen hat: Die Kollegin, die er schätzt und kennt oder ein Fehler im System, der droht auszubrechen? Nicht nur die Intentionen des „Puppetmaster“ bleiben ungewiss, auch die Hauptfigur ist sich ihrer Rolle in dieser Scharade nicht so bewusst, wie sie anfänglich denkt.

Maschinelle Menschlichkeit
Ghost in the Shell erzählt eine komplexe Geschichte, in der die Eskalation eher auf intellektueller Basis angedeutet wird. Viele Fetzen eines möglichen Ausgangs flattern in der dichten Atmosphäre umher und bieten einen Cyberthriller, der sich zusätzlich durch seine Auseinandersetzung mit existenzialistischen Hypothesen auszeichnet. Auch dieser Aspekt bedient sich primär am Subjekt der Protagonistin. Stetig in Konfrontation mit Fragen, deren Antworten entschieden gröber ausfallen, plagen sie Zweifel an der Identität und somit am Sein. Täglich wird sie Zeuge von metaphysischen Gesetzesbrüchen. Ein einfacher Müllmann wird von Polizisten verhört und muss akzeptieren, dass sein Leben eine virtuell generierte Lüge ist. Die Erinnerungen an eine Ehefrau und gemeinsame Tochter sollen das Resultat eines Hackers sein, der den Ghost des Mannes manipuliert und eine Fiktion eingepflegt hat. Dass sich die Erinnerungen dennoch so echt anfühlen, überfordert ihn. Kann das unechte Leben denn eine Lüge sein, wenn die Erinnerungen sich aber so echt anfühlen?
Gar reflexartig macht sich Majorin Kusanagi Gedanken, wie sehr sich ihr Leben von dem des armen Mannes im Verhör unterscheidet. Der einzige Unterschied zwischen ihnen ist, dass letzterer Gewissheit hat. Jeden Funken Menschlichkeit verdankt sie Wissenschaftlern, welche Zahlen und Daten in eine Tastatur eingetippt haben, um eine Waffe des Staates zu bauen. Würde besagte Waffe an Funktionstüchtigkeit einbüßen und nicht mehr konstant nach Befehl eines betätigten Abzuges feuern, würde sie eingezogen und generalüberholt oder komplett entwertet werden. Eher beiläufig entsteht dieser Gedanke in einem Gespräch zwischen ihr und Batou, als sie über das theoretische Szenario einer Kündigung reden. Doch führt der lange Rattenschwanz zum Kern, der plötzlich alles andere als unwahr erscheint.
Maschinell ist die Menschlichkeit Kusanagis, ganz gleich wie sehr sie sich zur Abkapselung ihres biokybernetischen Ursprungs bemüht. Eine Szene, in der sie in ihrer Freizeit auf einem Tauchgang näher zur Oberfläche emporsteigt und ihr Spiegelbild dabei mehr und mehr verschwimmt, wird zum Sinnbild der Identitätskrise, welche wie ein Pilz wächst und gedeiht. Und dies ist einer von vielen potenziellen Pilzen, die sich auf dem Stamm diverser Cyborgs ausbreiten könnten. Kusanagi kann sich fast glücklich schätzen, dass solche Unsicherheiten überhaupt aufkommen und reflektiert werden können. Der Müllmann hat dieses „Glück“ nicht und erfährt einen Weckruf, der einer Kollision gleichkommt.

Bilder für die Ewigkeit
Ghost in the Shell kann die Aufmerksamkeit der Zuschauerschaft durchaus strapazieren, da viele Dialoge gespickt sind mit technologischen Fachtermini und tiefgründigen Konversationen, nicht selten sprunghaft vorgetragen und von Szenenwechseln im Keim erstickt. Das Drehbuch gibt sich der vollen Exposition hin und lässt dabei dennoch endlosen Interpretationsfreiraum, da im Geiste des Genres nicht alle Fragen wirklich beantwortet werden. Die Reizüberflutung bleibt anstrengend, doch die Anstrengung bleibt positiver Art. Vorzüglich wird ein Mahl erst dann, wenn es einem so gut schmeckt, dass man trotz Übersättigung hungrig bleibt. Selbiges gilt für die audiovisuelle Umsetzung des Szenarios, welches komplementär zur Story Bilder zeichnet, um deren Ausstellung sich Museen bekriegen würden.
Der Kampf zwischen einem Gangster und einer weiblichen Silhouette in einer riesigen Pfütze ist nur eines von vielen Highlights, die das World-Building aufblühen lassen. Das Setting ist fortgeschritten und doch so rudimentär, als habe die Metropole alles Organische vertrieben und durch Attrappen einer realen Welt ersetzt. Das Anorganische der Stadt ist zum Organischen gereift, Kusanagi schaut von ihrem Apartment einem Panorama steriler Wolkenkratzer und der krakeelenden Infrastruktur Tokios entgegen. Wenn in einem furiosen Finale zu fliegenden Patronen und einstürzenden Säulen dann noch die geniale, transzendentale Musik von Kenji Kawai zu hören ist, ist das Publikum gänzlich umhüllt. Damit kommt es dem Zustand nahe, den die Geschichte illustriert. Inmitten verregneter Straßensperren und geheimen Untersuchungslaboren findet sich wenig Platz für die Entfaltung des Seins, die Protagonistin nennt jene Grenzen seit dem ersten Atemzug ihr Zuhause.
GHOST IN THE SHELL IST AKTUELL (STAND: 05. MAI 2025) AUF AMAZON PRIME VIDEO VERFÜGBAR
9.0 Punkte
Ghost in the Shell (1995) - Review
Dorian
Ähnliche Beiträge
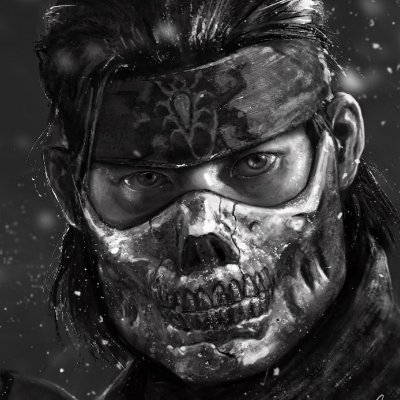
Die Leidenschaft Filme jeder Art in sich hinein zu pressen, entbrannte bei mir erst während meines 16. Lebensjahres. Seit diesem Zeitraum meines Daseins gebe ich jeder Bewegtbildcollage beim kleinsten Interesse eine Chance, seien es als Pflichtprogramm geltende Klassiker oder unentdeckte Indie-Perlen.
